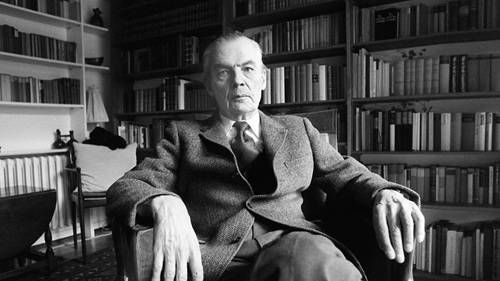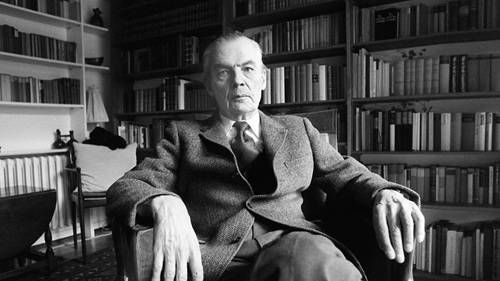Hans Erich Nossack
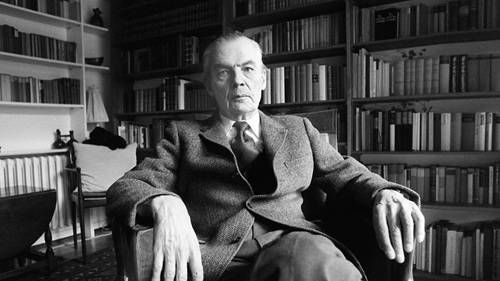
Spätestens im November
TAZ-Rezension aus dem Jahre 2020 von Frauke Hamann
Marianne Helldegen, 28, aus Uelzen, ist mit Max, einem
Nahrungsmittelfabrikanten, verheiratet. Ihr und dem kleinen Sohn fehlt es
vermeintlich an nichts in der Villa am Stadtrand. Höchst erfolgreich führt
Max die väterliche Firma, stiftet auch einen Literaturpreis, der
Reputation wegen. Bei der Verleihung ist er selbst dann nicht zugegen,
aber Marianne geht hin. Als sie dem einige Jahre älteren Preisträger
begegnet, Berthold Möncken, wissen beide sofort, dass sie
zusammengehören.
„Mit Ihnen lohnte es sich zu sterben“, sagt er zu ihr. Sie fahren zur
Helldegen-Villa, Marianne packt ein paar Sachen zusammen: „Ich wollte ja
auch nicht viel mitnehmen, wozu? Nur das Notwendigste.“ Sie spürt, dass es
die einzige andere Möglichkeit zu leben ist, die zu versäumen sie sich
ewig vorwerfen, ja woran sie zugrunde gehen würde. Als Max heimkehrt und
die beiden aufbrechen sieht, fragt er kühl: „Und der Zweck des
Unternehmens?“
Dass man mitmachen muss: Diese Haltung dementiert „Spätestens im
November“. Nossack (1901–1977) wählt als Erzählhaltung Mariannes
Bewusstseinsstrom: Im Rückblick tastet sie die entscheidenden acht Monate
ihres Lebens ab nach Möglichkeiten autonomer Perspektivgebung. „Es war
alles richtig, was wir taten“, denkt sie beim Verlassen der Villa.
Doch die Amour fou zum Schriftsteller Berthold gerät kaum drei Monate
später an einen toten Punkt, auch das spürt sie. Die Empfindungen des
Glücks verflüchtigen sich. „Er läßt sich nicht halten“, denkt Marianne,
fühlt sich überflüssig an der Seite eines Mannes, der ganz auf sein
Schreiben fokussiert ist.
Kurz entschlossen kehrt sie zu Ehemann und Sohn zurück, wird ohne ein Wort
des Vorwurfs wieder aufgenommen. „Gefühle haben keine lange Lebensdauer“,
ist Max überzeugt. Zäh und nüchtern müsse man sein, um Erfolg zu haben. Im
November kommt Berthold Mönckens neues Stück am Stadttheater zur
Uraufführung. Die Situation bei Helldegens ist angespannt, Marianne ist
sich sicher, dass Möncken sie abholen wird. So geschieht es auch: Nach der
Premiere klingelt es. Marianne trägt dasselbe Kleid wie im Frühjahr, packt
den Koffer und verlässt Mann und Kind erneut – ein Déjà-vu. „DEATH IS SO
PERMANENT“ steht auf dem Straßenschild an der unfallträchtigen Kurve, die
Marianne und Berthold passieren. Und der Roman endet wie ein Film der
Nouvelle Vague: Sie kommen zusammen ums Leben.
Nossack, 1919 Abiturient am traditionsreichen humanistischen Johanneum,
brach das dann begonnene Studium nach Fach- und Hochschulwechsel 1922
wieder ab. Von 1924 bis Mitte der 1950er-Jahre führte er ein Doppelleben:
Tagsüber arbeitete er in der väterlichen Kaffee-Import-Firma, die Abende
gehörten dem Schreiben. So resultieren Nossacks erzählerische Präzision
und sprachliche Klarheit aus einer Beobachterrolle, die er nicht nur dem
eigenen Brotberuf und sich selbst gegenüber einnimmt, sondern gegenüber
allen Menschen.
Mit klarem Blick legt er auch in „Spätestens im November“ die
Erfolgsfixiertheit und Sprachlosigkeit während der westdeutschen
„Wirtschaftswunderjahre“ bloß, erzählt vom wachsenden Wohlstand bei
gleichzeitiger Leere zwischen den Menschen. „Wir dürfen keinen Fehler
machen, wollte ich zu ihm sagen, doch als ich ihn ansah, ließ ich es“,
heißt es am Anfang des Romans. Warum sind alle Protagonisten gefangen in
Konventionen? Welche Entfaltungsmöglichkeiten hat Marianne in der Ehe mit
dem Vorzeige-Unternehmer? Warum kann dieser die Familie nur als Hort des
Konformismus begreifen? Und was kann ein Schriftsteller bewirken, der die
eigenen Werke geringschätzt und die erhaltene Urkunde nach der
Preisverleihung zerreißt?
Man muss sich Nossack als spröden Menschen vorstellen, unsentimental,
lakonisch. Über seine „Mutterstadt“ Hamburg schrieb er 1964 in sein
Tagebuch: „Es ist unmöglich, zugleich Hamburger und geistiger Mensch zu
sein. Das sind unvereinbare Dinge.“ Über seine Wirkung als Schriftsteller
hegte er keine Illusionen: „Man muß entweder ganz großen Erfolg haben oder
gar nicht erst anfangen.“ Gut, dass Nossack schließlich ganz beim
Schreiben blieb, gefördert übrigens von einem Unternehmer.
Er war überzeugt: Nichts für die eigenen Sachen zu tun, ist richtig, dann
machen sie selbst ihren Weg, und sei es nach vielen Jahren. Das gilt
gewiss für Nossacks Prosatext „Der Untergang“ (1948), im
Nachkriegsdeutschland eine der ersten literarischen Befassungen mit den
Schrecken des Bombenkriegs. Es gilt unbedingt aber auch für „Spätestens im
November“, seinen bis heute erfolgreichsten Roman.